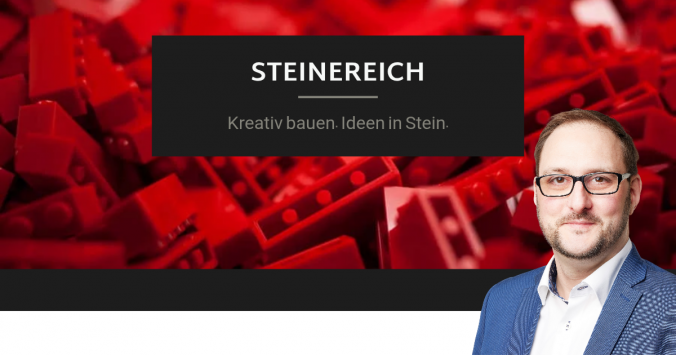Es fällt mir nicht leicht, diese Zeilen zu schreiben. Politik war für mich nie nur ein Hobby – sie war und ist ein Teil meiner Persönlichkeit. Meine politische Identität ist klar: geprägt von Willy Brandt und seinen Texten in der sozialistischen Internationale, d.h. links und demokratisch-sozialistisch. Ein politischer Weg also, der Reformen sucht, ohne die Vision zu verlieren; der den Menschen in den Mittelpunkt stellt; der Freiheit, Solidarität und Fortschritt miteinander verbindet – eben das, was man unter der ursprünglichen Definition von Sozialdemokratie versteht.
Doch wer lange aktiv war, und dies obendrein in zwei Parteien, der spürt irgendwann den Druck, der von zwei Seiten ausgeht.
Die Seeheimer in der SPD waren mir zu konservativ, zu weit entfernt von der mutigen Politik, die ich mir wünsche. Und die deutliche Verschiebung der SPD, weg von ihrem Grundgedanken des demokratischen Sozialismus, weg also von ihrem sozialdemokratischen Markenkern, war und ist mir zu weit weg von meiner politischen Überzeugung. Die Strömungen am linken Rand der Linken wiederum bewegen sich für mich zu sehr in Richtung eines Systemwechsels durch Umsturz. Ein Kurs, den ich ebenfalls nicht mittragen kann, da Ich zwar zutiefst an Veränderung und die Notwendigkeit dazu glaube, aber an eine Veränderung, die demokratisch, reformistisch, verantwortungsvoll und zugleich ambitioniert erarbeitet wird.
Ein innerer Prozess, der Kraft gekostet hat
Politisches Engagement braucht für mich ein tragfähiges Fundament. Ich muss mich auf ein Grundsatz- oder Partei- und Werteprogramm stützen können, dessen Inhalte ich in sehr großem Umfang teile. „Sehr großer Umfang“ bedeutet für mich: mindestens 80 % der Grundsätze, Ziele und Werte müssen mit meinen eigenen Überzeugungen übereinstimmen. Nur dann kann ich meine Energie voll entfalten und einbringen – nur dann empfinde ich politisches Engagement als sinnvoll und ehrlich.
Der Wechsel zur Linken war daher getragen von Aufbruchsstimmung. Ich war überzeugt, dass die Programmatik dieser Partei meinem eigenen Verständnis von Gerechtigkeit und Solidarität deutlich näherkommt – steht sie doch in vollkommener Übereinstimmung mit den Texten und Reden Willy Brandts. Für kurze Zeit hat mich das tatsächlich beflügelt – ich schrieb, diskutierte, dachte, plante.
Doch dieser Funke hielt nicht lange. Der Wechsel von einer Partei in die andere – und die damit verbundene Hoffnung auf einen Neuanfang – war rückblickend zu abrupt für das, was ich innerlich verarbeiten muss. Die Demotivation, die ich in der SPD schon intensiv gespürt hatte, kehrte zurück. Diskussionen, die mir früher Freude machten, wurden zu Belastungen. Mein Blog, mein eigentliches Ventil, blieb zunehmend liegen – ein deutliches Zeichen dafür, dass meine innere Kraft und Motivation schwindet.
Parallel dazu wurden mir die tiefgreifenden, am reformistisch-demokratischen Parteiprogramm rüttelnden Richtungsdebatten innerhalb der Linken immer präsenter: Reform oder Umbruch? Pragmatismus und Reformismus oder Konfrontation? Richtungsdiskussionen sind in jeder Partei völlig normal, für mich aber zunehmend zermürbend – insbesondere als vehementer Gegner erzwungener Systemumstürze.
Ich habe lernen müssen, dass eine Partei, selbst wenn man ihre Grundwerte teilt, ein Ort sein kann, der einem die Freude an politischer Arbeit nimmt. Und das bei aller Klarheit darüber, dass dem nicht so sein sollte – und schon gar kein zweites Mal!
Der schwierigste Schritt: Abstand
Ich habe versucht, mich zurückzuziehen, Verantwortung abzugeben, Termine zu reduzieren und Diskussionen aus dem Wege zu gehen. Doch selbst wenn der Kalender frei war, fühlten sich Parteitreffen wie eine Pflicht an. Politische Gespräche gaben mir keine Energie mehr, sondern raubten sie mir. Das ist kein Zustand, in dem Engagement aufblühen kann.
Darum ziehe ich – schweren Herzens, aber überzeugt – die Konsequenz:
Ich nehme Abstand. Nicht von meinen Überzeugungen, nicht von meinem politischen Kompass, nicht von meinen Idealen. Aber vom Apparat, vom Parteileben, von den Strukturen, die mir im Moment mehr schaden als nutzen.
Ich möchte wieder zu mir selbst finden. Wieder Freude empfinden, wenn ich politische Texte schreibe oder politische Diskussionen führe. Wieder Energie daraus ziehen, über die Zukunft unserer Gesellschaft nachzudenken.
Dieser Entschluss richtet sich nicht gegen Menschen, die meinen Weg über Monate und Jahre hinweg begleitet haben. Es ist eine persönliche Entscheidung, die aus innerer Notwendigkeit entsteht – nicht aus Enttäuschung über andere.
Und wie geht es weiter?
Ich weiß es noch nicht. Vielleicht finde ich nach einer Phase der Ruhe wieder den Weg in aktive politische Arbeit zurück. Vielleicht verlagert sich mein Engagement künftig stärker in unabhängige Räume. Auch dort kann man Demokratie vertreten, verteidigen und so letztendlich zu Ihrem Erhalt beitragen. Sicher ist nur: Meine politischen Überzeugungen bleiben. Mein Wunsch nach einer gerechteren, bunteren, solidarischen und freiheitlichen Gesellschaft bleibt. Mein Bekenntnis zu sozialdemokratischen und damit verbunden demokratisch-sozialistischen Werten bleibt.
Ich schreibe diesen Beitrag, weil er Teil meiner Selbstreflexion ist. Weil ich ehrlich zu mir selbst sein möchte. Und weil ich glaube, dass es manchmal mutiger ist, einen Schritt zurückzugehen, statt sich in Strukturen festzubeißen, die einem nicht guttun.
Dieser Schritt schmerzt. Aber er fühlt sich richtig an.